Familiendynamik, 2024, Jg. 49, Ausgabe 3
Kollektive Traumata
Print-Ausgabe
eJournal
Bibliographische Angaben
Details
Kollektive und intergenerationale Traumata sind nicht nur psychische Phänomene, die in der Psychologie und Psychotherapie diskutiert werden, sondern auch soziale Phänomene, die die Sozialwissenschaften erforschen. Sie können daher auch aus soziologischer Perspektive beschrieben werden. Interdisziplinäre Ansätze eignen sich besonders, die miteinander verschränkten kollektiven und individuellen Ebenen und Folgen von traumatischen Erfahrungen zu entwirren. In diesem Beitrag verwende ich den quanten-sozialwissenschaftlichen Ansatz von Matoba (2022a) und den kollektiven Integrationsansatz von Hübl (2020), um die individuelle psychische und kollektive soziologische Pathologie von kollektiven und intergenerationalen Traumata zu beschreiben sowie die Funktionen und Mechanismen dieser Phänomene zu untersuchen. Dieser Aufsatz gliedert sich in drei Abschnitte: Landschaft des kollektiven und intergenerationalen Traumas, kollektive und intergenerationale Trauma-Integration und Perspektiven für weitere empirische Forschung – Letzteres auch, da eine empirische Verifizierung des Ansatzes unter kontrollierten Bedingungen noch aussteht.
Collective and intergenerational traumas are not only psychic phenomena discussed in psychology and psychotherapy, they are also social phenomena investigated by the social sciences. Accordingly, they can be discussed from a sociological perspective. Interdisciplinary approaches are especially promising in unravelling the entanglements between the individual and the collective dimensions and consequences of traumatic experience. This article draws upon the quantum social-science approach proposed by Matoba (2022a) and Hübl’s collective integration approach (2020) to describe the individual psychic and collective-sociological pathology of collective and intergenerational traumas and to investigate their functions and mechanisms. The discussion divides into three sections focussing on (a) the landscape of collective and intergenerational traumas, (b) collective and intergenerational trauma integration and (c) perspectives for further research, the latter not least because there has as yet been no empirical verification of the approach under controlled conditions.
Die systemische Aufstellungsarbeit hat sich über viele Jahre vom Familienstellen sehr facettenreich weiterentwickelt und ist heute sowohl im therapeutischen Kontext als auch in der Beratung von Organisation und Unternehmen eine etablierte Methode. In den letzten Jahren ist eine zunehmende Auseinandersetzung mit dem Thema Trauma und dem traumaspezifischen Vorgehen in Aufstellungen zu beobachten.
Der Beitrag greift aus der anwenderbezogenen Perspektive das Zusammenwirken klassischer Aufstellungsarbeit mit Elementen aus der therapeutischen Traumaarbeit auf. Der Fokus liegt darauf, eine Kombination aus weiteren methodischen Möglichkeiten zu entwickeln, um einen traumainformierten Prozess und die Möglichkeit der Traumaintegration zu erreichen.
Dabei geht es zum einen um den Collective Trauma Integration Process (CITIP) nach Thomas Hübl und zum anderen um Erkenntnisse, die der Autor gemeinsam mit Sabine C. Langer seit 2017 in dem von ihnen initiierten und durchgeführten Projekt
Systemic constellation work has developed in many different ways over the years from family constellations and is now an established method both in a therapeutic context and in consulting for organizations and companies. In recent years, there has been an increasing focus on the topic of trauma and the trauma-specific approach in constellations.
This article takes up the interaction of classical constellation work with elements from therapeutic trauma work from a user-oriented perspective. The focus is on developing a combination of further methodological possibilities in order to achieve a trauma-informed process and the possibility of trauma integration.
This involves, on the one hand, the Collective Trauma Integration Process (CITIP) according to Thomas Hübl and, on the other hand, insights that the author has gained together with Sabine C. Langer since 2017 in the project ZUFLUCHT-ZUVERSICHT-ZUKUNFT, which they initiated and implemented. The project deals with the topic of flight and expulsion at the end of the Second World War as well as individual, transgenerational and collective trauma.
Das von Masud Khan (1963) begründete Konzept des kumulativen Traumas findet mit Blick auf die neuere Traumaforschung kaum Beachtung und wird, wenn überhaupt, als deskriptive Kategorie herangezogen, ohne das subtile, aber wiederholte Aussetzen elterlicher Fürsorgefunktionen zu berücksichtigen, welches nach Kahn jedoch der entscheidende traumatogene Faktor ist. Nach einer Rekapitulation der ursprünglichen Konzeptualisierung und ihrer wichtigsten Eckpunkte wird das kumulative Trauma mit aktuellen Forschungszusammenhängen wie der Bindungstheorie, dem Entwicklungstrauma und der Mentalisierungsforschung verknüpft und letztlich als ein Beitrag zum Verständnis der transgenerationalen Transmission von komplexen Traumatisierungen im Kontext von Krieg und Flucht begriffen.
The concept of Cumulative Trauma as established by Khan (1963) has hardly been taken into account in recent trauma research literature except as a purely descriptive category ignoring the suspension of the parental care function that Khan identified as the decisive traumatogenic factor in the traumatization of children. After a recapitulation of its original conceptualization, Cumulative Trauma is linked here to current research approaches (attachment, mentalization, etc.) and ultimately recommended as a theoretical approach in understanding the transgenerational transmission of complex traumas affecting war refugees.
Dieser Artikel bietet Einblicke in die Praxis und die wissenschaftliche Begleitung des Mental Health Center Ukraine* (MHCU), welches von Refugio München für Geflüchtete aus der Ukraine gegründet wurde. Ziel der hier vorgestellten Studie ist eine genauere Beschreibung der behandlungsaufsuchenden Menschen mit ihren Belastungen, Ressourcen und den sich daraus ergebenden Bedarfen. Erste Ergebnisse deuten auf eine hohe Belastung hin, insbesondere bzgl. posttraumatischer und depressiver Symptomatik. Die schnelle Etablierung von muttersprachlichen psychosozialen Versorgungsprojekten erscheint angesichts der hohen Belastung zentral für Geflüchtete. Die Daten deuten auf die Relevanz von Behandlungen hin, die Familienmitglieder berücksichtigen, sowie den Bedarf an kurz- wie auch langfristigen intensiven psychotherapeutischen Angeboten.
The article provides information on the practice and the scientific credentials of the Mental Health Center Ukraine* (MHCU) established by Refugio Munich for refugees from Ukraine. The aim of the study discussed here is to arrive at a more precise description of the refugees seeking treatment, the kinds of stress weighing down on them, their resources and the needs resulting from this constellation. Initial outcomes indicate a high degree of stress, notably in connection with posttraumatic and depressive symptomatologies. Given this serious stress component, it would appear to be of central significance for refugees to be involved in psychosocial care projects in their mother tongue. The data indicate the relevance of treatment formats that take account of family members and the need for intensive, short- and long-term psychotherapeutic interventions.
Der durch die europäische Kultur geprägte Mensch der sogenannten westlichen Welt erlebt derzeit eine Fülle von Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, damit unsere Enkel auf dieser Erde noch ein lebenswertes Leben führen können. Für die notwendige Transformation vor allem der Markt- und Finanzwirtschaft, der Landwirtschaft, der Organisation der Unternehmen und Betriebe, des Verkehrs und der Verteilung von Besitz und Einkommen sind inzwischen bewundernswert viele Konzepte entwickelt worden. Demgegenüber gibt es kaum Ideen dazu, wie sich das Selbstbild der Menschen, die diese Transformationen vollziehen oder zumindest tolerieren müssen, verändern muss. Dazu wird es notwendig sein, sich von der Idee des Menschen als Individuum zu verabschieden und ein neues Menschenbild zu entwickeln, in dem – in welcher Form auch immer – die Merkmale wieder dominieren, die vor etwa 70 000 Jahren den großen Schritt zum Homo Sapiens ausgemacht haben (Henrich, 2022; Bleckwedel, 2022): soziale Beziehungsfähigkeit, Kooperation und eine gemeinsam geteilte kommunikative Kultur.
At present, the denizens of the so-called western world with their roots in European culture are facing a number of challenges that will need to be dealt with successfully if our grandchildren’s lives on this planet are to be worth living. A remarkable number of strategies have been proposed for transforming the market and finance economies, agriculture, business organisation, traffic / transport and the distribution of property and income. By contrast, hardly any ideas have been advanced on how the self-image of the individual would need to change in order to consummate or at least tolerate these transformations. Here, it will be imperative to take leave of the individualist idea of humanity and replace it with a new image of humankind. This image would need to foreground the features that about 70,000 years ago paved the way for the epoch-making developments culminating in the emergence of
Die Abrechnung von Systemischer Therapie über die gesetzlichen Krankenkassen erfordert die Vergabe von Diagnosen, obwohl die Systemik diesen traditionell auch kritisch gegenübersteht. Dieses Scoping Review identifiziert aus 54 relevanten theoretischen Arbeiten seit 2006 eine Reihe von Pro- und Kontra-Argumenten in Bezug auf psychiatrische Diagnosen in der Systemischen Therapie. Dabei zeigt sich, dass die Argumente gegen die Verwendung von Diagnosen (z. B. »Fehlende Aufmerksamkeit für den sozialen Kontext«) die Diskussion numerisch dominieren, während sich Pro-Argumente (z. B. »Anschlussfähige Kommunikation im Gesundheitswesen«) seltener finden. Konträr hierzu zeigt sich aus der Gesamtbewertung der Texte jedoch eine mehrheitlich positive Bereitschaft, mit Diagnosen zu arbeiten. Daraus folgern wir eine »Sowohl-als-auch-Haltung« als typisch für die Systemische Therapie und diskutieren, wie die ambulante Systemische Therapie trotz der Integration in das deutsche Gesundheitssystem ihre besondere Perspektive bewahren kann.
For the remuneration of systemic therapy invoices in the German medical insurance system, reference to diagnoses is imperative, although the systemic approach is traditionally critical of this kind of appraisal. The present scoping review draws on 56 relevant theoretical studies and articles from 2006 to the present to single out the main arguments both for and against recourse to psychiatric diagnoses in systemic therapy. It transpires that the arguments querying diagnoses (e. g. »lack of attention to the social context«) figure more largely in the discussion than the arguments in favour of diagnosis (e. g. »facilitate communication in the health system«). The overall evaluation of the material indicates, however, that in most cases there is in fact an overall readiness to work with diagnoses. Our conclusion from this is that a »both-and« mentality is typical of the systemic approach. Accordingly, the article closes with a discussion of the extent to which, despite integration into the German health system, outpatient systemic therapy can remain true to its convictions.
Autor:innen
Jörn Borke(Hrsg.)
Christina Hunger-Schoppe(Hrsg.)
Rieke Oelkers-Ax(Hrsg.)
Mathias Berg(Hrsg.)
Hefte der gleichen Zeitschrift
Alle Hefte der Zeitschrift
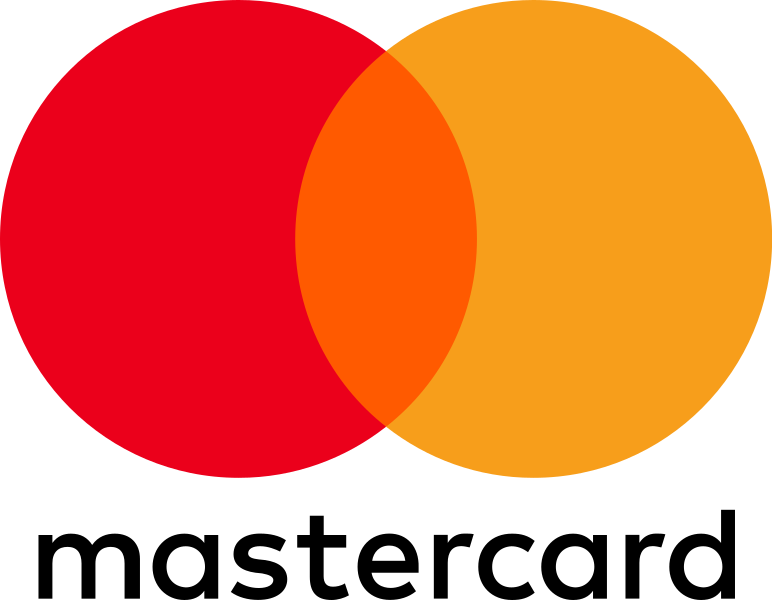

Bestell-Informationen
Service / Kontakt
Kontakt



