Trauma & Gewalt, 2008, Jg. 2, Ausgabe 3
eJournal
Bibliographische Angaben
Details
Seelische Störungen bei Teilnehmern des Ersten Weltkrieges wurden als Ausdruck von Feigheit verstanden oder angeblich schon vorher bestehenden Auffälligkeiten zugeschrieben. Ebenso wurden psychische Erkrankungen nach Haft im Konzentrationslager über lange Zeit nicht mit der dortigen Exposition an Tod und Folter in Verbindung gebracht. Erst nach dem Vietnam-Krieg etablierte sich die Erkenntnis von der pathogenen Wirkung erlebter Gewalt. Nach zögerlichem Start ist mittlerweile auch in Deutschland die Psychotraumatologie als Lehre seelischer Verletzungen durch Gewalterfahrungen und als Lehre ihrer Therapie aus dem Kanon der medizinischen Fächer nicht mehr wegzudenken. Allerdings ist ihre vordergründige Schein-Akzeptanz zu differenzieren von einem empirisch gestützten und konzeptuell getragenen Engagement für diese neue Disziplin. Die Arbeit gibt eine Einführung in verschiedene Aspekte ihrer Genese und in einige ihrer Organisationsformen.
Psychic disorders displayed by members of the armed forces in World War One (WW I) were interpreted as cowardice or ascribed to intrinsic character anomalies assumed to have existed beforehand. And for a long time, mental illness following imprisonment in concentration camps was not thought to have any connection with the exposure to torture and death typical of such settings. Only after the Vietnam War was the pathogenic effect of the experience of violence finally recognized. After a hesitant start, psychotraumatology – the study of psychic damage caused by the experience of violence and the forms of therapy available for dealing with such damage – has now established itself as a fixture in the curricula of German medical schools. A distinction should be made, however, between its apparent acceptance and an empirically substantiated and conceptually sustained commitment to this new discipline. The article provides an introduction to various aspects of the emergence of psychotraumatology and a number of the organizational forms it has taken.
Die statistische Gefahr, Opfer einer Geiselnahme oder Entführung zu werden, rückt inzwischen – unter Berücksichtigung der Berufsgruppenzugehörigkeit – für viele in greifbare Nähe. Das gilt z. B. für die zu den hochrisikoreichen Berufen zählende Tätigkeit als Bedienstete/r einer Justizvollzugsanstalt. Unter Globalisierungsaspekten steigt das Risiko noch um ein Vielfaches: nämlich für in Krisenherden tätige Personen wie beispielsweise Einsatzkräfte oder Journalisten. Auch Privatunternehmer und ihre Angestellten geraten zunehmend in das Visier der auf Entführungen spezialisierten Täter. Mittlerweile hat sich eine regelrechte Entführungsindustrie ohne Grenzen formiert.
Im Fokus des nachfolgenden Beitrags steht neben Hintergründen des Phänomens »Entführung« die perspektivische Betrachtung der verschiedenen Stadien einer Entführung. Psychologische Korrelate der verschiedenen Stadien auf
Opfer- und Täterseite finden genauso Berücksichtigung wie Verhaltens- und Handlungsstrategien eines Opfers, die für das psychische und physische Überleben von essentieller Bedeutung sein können. Weiter stellt sich die Frage, ob es Charakteristika von Personen, gibt, welche dazu beitragen, eine Entführung besser zu überstehen als andere. Zentrales Anliegen der Autorin ist die Vermittlung von Einblicken und Erkenntnissen, die im Rahmen langjähriger einschlägiger polizeilicher Einsatz- und Beratungstätigkeit sowie in der Betreuung und Therapie von Entführungsopfern gesammelt wurden; außerdem soll die internationale Befundlage zu dieser Thematik dargestellt werden.
For members of a number of professions, the statistical likelihood of becoming a victim of hostage-taking or kidnapping is on the increase. One example is the high risk involved in working at a prison. Globalization makes the hazards even greater, affecting people operating in conflict areas, such as journalists, aid workers, or members of the armed forces. Private entrepreneurs and their employees are also much-favored targets of criminals specializing in kidnapping. Today, a veritable cross-border kidnapping industry has evolved. The article focuses not only on the causes behind the kidnapping phenomenon but also on the different stages involved in such a crime. It discusses psychological correlations between victim and perpetrator at different junctures of a kidnapping and outlines strategies for behavior and action on the part of the victim that may be essential for physical and psychological survival. Another issue is the question whether certain personal characteristics may be conducive to survival in a kidnapping scenario. The author’s central concern is to discuss the state of international research on this topic against the backdrop of her own personal insights and findings. These insights stem both from many years’ experience as a counselor to the police in connection with such incidents and from her work as a caregiver and therapist for hostage victims.
Ergebnisse einer fragebogengestützten Querschnittserhebung bei Einsatzkräften der Bundespolizei werden berichtet. Ziel der Untersuchung war zum einen, dienstespezifische Anforderungen und Belastungen zu identifizieren. Zum anderen sollten Zusammenhänge zwischen belastungswirksamen Anforderungen und Burnout abgebildet werden. Darüber hinaus interessierte die Häufigkeit des Erlebens potenziell traumatisierender Einsatzsituationen und die Prävalenz von Symptomen der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Zur Klärung der Frage, ob Beamte, die durch Belastungen im Einsatzalltag bereits Merkmale von Burnout ausgebildet haben, auch vulnerabler für psychische Traumafolgestörungen nach hoch belastenden Einsätzen sind, wurden Zusammenhänge zwischen Burnout und Symptomen der PTBS untersucht. Die Untersuchung ergab, dass in der Bundespolizei am häufigsten behindernde arbeitsorganisatorische Rahmenbedingungen erlebt werden. Ca. 13 % der Einsatzkräfte können als hochgradig ausgebrannt bezeichnet werden. Besonders auffällig ist das herabgesetzte berufliche Wirksamkeitserleben. Insgesamt begünstigt insbesondere die häufige Konfrontation mit arbeitsorganisationsbezogenen Belastungen Burnout. Zwischen Merkmalen von Burnout und Symptomen der PTBS nach einem potenziell traumatisierenden Ereignis fanden sich lediglich schwache Zusammenhänge. Die Ergebnisse lassen dennoch annehmen, dass Burnout ein (wenn auch schwacher) Indikator der individuellen Vulnerabilität für die Ausbildung posttraumatischer Symptome nach potenziell traumatisierenden Einsätzen darstellt. Da Burnout insbesondere durch das Erleben belastender arbeitsorganisationsbezogener Rahmenbedingungen beeinflusst wird, gewinnen auch Maßnahmen der Organisationsentwicklung in der primären Prävention von psychischen Traumafolgestörungen an Bedeutung.
The article gives an account of the findings of a questionnaire-based cross-section survey of German police officers. One of the aims of the study was to identify the demands made on police officers in the course of their duties and the stress involved. Another was to delineate the connections between the stress involved in their work and burnout syndromes. A further focus was on the frequency with which police officers encounter potentially traumatic situations on the job and the prevalence of PTSD symptoms (posttraumatic stress disorder). Parallels between PTSD and burnout were investigated in an attempt to find out whether police officers already displaying burnout symptoms as a result of everyday work stress were more susceptible to posttraumatic disorders after highly stressful missions. The study indicated that the most frequent cause of burnout in the federal police force is having to deal with work-organization parameters that are experienced as stressful. About 13 % of the police officers can be regarded as significantly affected by burnout symptoms. Especially notable is the subjective experience of futility in their everyday work. There were only minor indications of a connection between burnout symptoms and PTSD symptoms in the aftermath of potentially traumatic events. The findings do however suggest that burnout is a (weak) indicator of individual vulnerability to the development of posttraumatic symptoms after potentially traumatic missions. As burnout is significantly influenced by the experience of stressful work-organization parameters, it is fair to assume that the prevention of posttraumatic psychic disorders may be enhanced by measures designed to improve organizational factors.
Kommunale Kriminalprävention ist ein verbreitetes und allgemein akzeptiertes Konzept, obwohl umfassende Evaluationsstudien weitgehend fehlen. In der vorliegenden Studie wurde eine Form der praktischen Umsetzung von Kommunaler Kriminalprävention untersucht, das »Heidelberger Modell«. Darunter verstehen die Betreiber einen ursachenorientierten, theoretisch fundierten und empirisch untermauerten Präventionsansatz, bei dem Polizei, Kommunen, Zivilgesellschaft und Wissenschaft vernetzt agieren. Die Grundlage der Evaluation bilden insbesondere Bevölkerungsbefragungen im Rhein-Neckar-Kreis und Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik. In den letzten 10 Jahren hat sich in der Region die Kriminalitätsfurcht erheblich verringert, und die Kriminalitätsbelastung ist gesunken – im Gegensatz zu Vergleichsregionen. Zudem kann gezeigt werden, dass mit zunehmender Anzahl von langfristigen Präventionsprojekten ›incivilities‹, also Anzeichen sozialer Erosion, abgebaut wurden und dadurch die Kriminalitätsbelastung und das Niveau der Kriminalitätsfurcht geringer wurden. Insgesamt gesehen sprechen die Untersuchungsergebnisse für einen kriminalpräventiven Erfolg dieses Konzepts.
Communal Crime Prevention is a widespread and generally accepted approach, despite the almost complete absence of comprehensive studies attempting an evaluation of it. The study reported on here investigates one practical implementation of Communal Crime Prevention, the so-called »Heidelberg model.« Its operators define it as a cause-based, closely reasoned, and empirically substantiated approach to crime prevention in which the police, communities, civil society, and science act in concert. The evaluation is based on responses to survey questionnaires distributed to the population of the Rhine-Neckar region and police crime data. In the last 10 years both fear of crime and crime stress have substantially decreased here – in contrast to other regions. There are also indications that the increasing number of long-term prevention projects have been operative in reducing »incivilities« (signs of social erosion), with a beneficial effect on crime stress and the degree of crime fear. In sum, the findings of the investigation indicate that this approach has been successful in preventing crime.
Die Berichterstattung über Krisen, Katastrophen und Unglücksfälle ist ein wichtiger Aufgabenbereich für Journalisten. Nicht selten gehören sie zu den ersten, die neben dem Rettungspersonal am Ort des Geschehens eintreffen. Während die psychische Belastung dieser Arbeit bei den helfenden Berufsgruppen inzwischen gut erforscht ist, liegen kaum Studien über Personen vor, die im Medienbereich tätig sind. Der vorliegende Artikel fasst den bisherigen Stand der Forschung kritisch zusammen und zeigt, dass auch Medienschaffende häufig potentiell traumatische Erfahrungen machen. Ein substanzieller Teil von ihnen entwickelt in der Folge posttraumatische Symptome oder andere psychische Beschwerden. Im Vergleich zu helfenden Berufsgruppen ist diese Rate allerdings tendenziell geringer. Gründe für diesen Unterschied werden diskutiert. Zukünftige Studien im Bereich Trauma und Journalismus sind notwendig und sollten methodische Aspekte (z. B. angemessene Kontrollgruppen oder eine Unterscheidung zwischen berufsbedingten und persönlichen Traumata) stärker beachten.
Reporting on crisis areas, disasters and accidents is part and parcel of a journalist’s profession. Frequently reporters are the first to arrive on the scene, together with ambulance and first-aid workers. Whereas the psychological distress involved in the work of paramedics has been quite extensively studied, there has been little investigation of the effect of potentially traumatic situations on people working for the media. This article provides a critical summary of the state of research on this issue to date and indicates that journalists, press photographers, camera crews etc. are frequently confronted with scenes of a potentially traumatic nature. Subsequently a substantial proportion of them develop posttraumatic symptoms or other psychological complaints. Compared to paramedics the rate does, however, tend to be lower. The article discusses possible reasons for this fact. In future, more studies on the links between trauma and journalism are required. They should pay greater attention to methodological aspects (such as appropriate control groups, the distinction between work-related and personal traumas, etc.).
Hefte der gleichen Zeitschrift
Alle Hefte der Zeitschrift
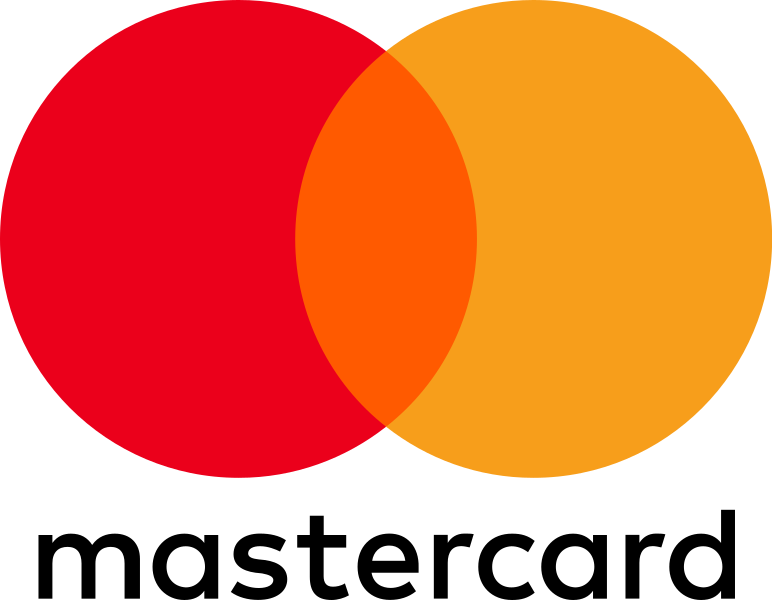

Bestell-Informationen
Service / Kontakt
Kontakt



