Trauma & Gewalt, 2007, Jg. 1, Ausgabe 1
eJournal
Bibliographische Angaben
Details
Wenn die sozialwissenschaftliche Forschung ihren Blick nicht nur auf Gewaltursachen, sondern auch auf das Gewaltgeschehen selbst richtet, muss sie feststellen, dass sich viele Aspekte mit Modellen rationalen Handelns nicht fassen lassen. Gewalt lässt sich nicht allein und manchmal überhaupt nicht in Kategorien von Mittel und Zweck angemessen begreifen. Dies versucht der Beitrag am Beispiel verschiedener Erscheinungsformen von Jugendgewalt nachzuweisen. Die fünf vorgeführten Einwände gegen rationalistische Handlungsmodelle gelten zunächst Ansätzen, die Gewalt prinzipiell als rationales Handeln deuten und den Blick auf situationsbezogene Anwendungsprobleme des Zweck-Mittel-Schemas verbauen. Schließlich wendet sich der Beitrag »intrinsisch motivierten« Gewalttaten zu, die einen selbstzweckhaften Charakter besitzen und auf eine prinzipielle Grenze von Modellen rationalen Handelns aufmerksam machen.
Summary
When sociological research focuses on violent acts and not only on the causes of violence, it finds that many aspects of the phenomenon cannot be grasped using models of rational action. The categories of “means” and “ends” alone cannot sufficiently explain violence; at times they cannot explain it at all. This essay attempts to demonstrate this by using, as examples, various forms of violence among young people. The five objections to models of rational action it presents correlate to approaches that interpret violence principally as rational action and obstruct the view of the problems associated with a situation-related application of the “means-ends” pattern. Finally, the essay addresses “intrinsically motivated” violent acts that are undertaken for their own sake and show the fundamental limits of models of rational action.
Ausgewählte Ergebnisse der Entwicklungsneurologie sowie der Stress-, Trauma-, Gedächtnis- und Bindungs-forschung werden referiert und gewürdigt im Hinblick auf ihre Relevanz für die aussagepsychologische Begutachtung der Veridikalität von kindlichen Aussagen zu fraglichen, strafrechtlich relevanten Ereignissen. Traumatischer Stress beeinträchtigt in vielfacher Hinsicht das neuronale Funktionsniveau und somit auch aussagerelevante Gedächtnisfunktionen. Die für psychotherapeutisches Handeln erforderlichen und hinreichenden Qualitätsstandards (Glaubwürdigkeit) einer Patientenaussage über ein therapeutisch relevantes äußeres Ereignis (sog. A-Kriterium) können sinnvollerweise geringeren Anforderungen genügen, als dies zwingend im Zuge einer forensischen Überprüfung erforderlich ist. An dieser Schnittstelle kommt es zwischen diesen beiden Sichtweisen zu einem Konflikt,
für den bis dato noch keine zufriedenstellende Lösung in Sicht ist.
Das Modell der pathologischen Dissoziation stellt die »Kontinuumshypothese« dissoziativer Phänomene in Frage, d. h. es bezweifelt eine dimensionale, im Schweregrad aufsteigende Verteilung dissoziativer Symptome. Vielmehr geht das Konzept davon aus, dass klinisch relevante Dissoziation sich qualitativ fundamental von leichteren Formen unterscheidet. Diese Annahme konnte mittels komplexer statistischer Verfahren auch empirisch bestätigt werden. Personen lassen sich demnach typologisch zu dem Taxon der pathologischen Dissoziation zuordnen. Wir stellen sowohl den historischen Hintergrund als auch die aktuelle Diskussion zu diesem Thema vor, fassen bisherige Arbeiten zur Häufigkeit, den soziodemographischen und klinischen Korrelaten der pathologischen Dissoziation zusammen und erörtern die kritischen Schwachstellen des Modells. In einem zweiten Schritt kontrastieren wir die psychometrischen Kennwerte der
acht Items umfassenden Subskala der Dissociative Experiences Scale (DES) zur Erfassung der pathologischen Dissoziation mit dem Fragebogen zu Dissoziativen Symptomen (FDS), der deutschen Version der DES, um abschließend Handlungsempfehlungen für den klinischen und wissenschaftlichen Einsatz abzuleiten.
The concept of pathological dissociation (PD) questions the validity of the so-called “dissociative continuum”, which has been one of the prevalent key principles in the field of dissociation. A sophisticated taxometric analysis of the Dissociative Experiences Scale (DES), the most widely used self-report questionnaire measuring dissociation empirically validated the distinction between a dimensional, non-pathological type and a discontinuous, pathological class of dissociation, which subjects can be assigned to. In our article, we summarize the historical background and introduce the current discussion on that topic. We describe the research on the frequency, sociodemographic and clinical correlates pf PD and highlighten critical aspects of this model. In a second part, we compare the “DES-Taxon”, an 8 item subset of the DES to assess PD, with the German version of the DES. On the basis of our results, we finally derive recommendations for the clinical and scientific use of either the DES-Taxon or the full-length DES.
Die Kriterien des DSM-IV und der ICD-10 für die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) unterscheiden sich in einigen zentralen Punkten, die wahrscheinlich für die geringen Übereinstimmungsraten der Diagnose von PTBS verantwortlich sind. Ziel dieser Studie ist es, die Diagnosehäufigkeiten zu vergleichen, die sich für die PTBS basierend auf den verschiedenen Diagnosekriterien ergeben. 311 Einwohner Sarajevos, aus dem ehemaligen Kriegsgebiet in Bosnien-Herzegowina, wurden dreieinhalb Jahre nach Kriegsende mit der Posttraumatischen Diagnose Skala (PTDS) und der Checklist of War Related Experiences untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer PTBS-Diagnose bei Anwendung der ICD-10-Kriterien im Vergleich zu den DSM-IV-Kriterien deutlich höher ist. Die Übereinstimmung zwischen ICD-10- und DSM-IV-Diagnosen ist gering. Die DSM-IV-Kriterien differenzieren stärker zwischen Behandlungsbedingungen und Geschlecht als die ICD-10-Kriterien.
DSM-IV and ICD-10 criteria for PTSD differ in important aspects which presumably are responsible for the low concordances for diagnoses between the two classification systems. The goal of this study is to compare the estimated rates for posttraumatic stress disorder (PTSD) based on different diagnostic criteria applied to self reports of symptoms by a sample of war zone exposed civilians in Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. 311 people were administered the Posttraumatic Diagnostic Scale (PTDS) and the Checklist of War Related Experiences. Rates for PTSD are much higher when ICD-10 criteria were applied as compared to DSM-IV criteria. The agreement between ICD-10 and DSM-IV is low. DSM-IV criteria differentiate better between treatment conditions and gender than ICD-10 criteria.
Beschrieben wird die Durchführung zweier Schulungsseminare in Sri Lanka für pädagogische und medizinische Mitarbeiter von Institutionen, die traumatisierte Kinder und Jugendliche nach dem Tsunami 2004 betreuen. Den meist psychotherapeutischen Laien wurden Grundkenntnisse in Psychotraumatologie, Ressourcenarbeit, den Therapieverfahren NET und EMDR vermittelt. Eigene Traumatisierungen dieser Helfer aus dem langjährigen Kriegsgebiet mussten einkalkuliert werden. Zwei Nachbefragungen am Ende der Seminare und 1/2 Jahr später zeigen, dass die Kenntnisse erfolgreich angewendet wurden. Intensivere Methoden-Trainings sowie die Unterstützung beim Aufbau eines Netzwerkes wurden gewünscht. Direkte Kontakte vor Ort sollen Aufschluss über die niedrige Rücklaufquote geben. Die Erkenntnisse fließen in die Durchführung diesjähriger Seminare ein.
Ein Behandlungsbericht über eine Psychoanalyse vor 20 Jahren wird unter heutiger psychotraumatologischer Sicht interpretiert. Statt einer Psychoanalyse wäre aus heutiger Sicht eine traumaadaptierte Therapie indiziert.
Hefte der gleichen Zeitschrift
Alle Hefte der Zeitschrift
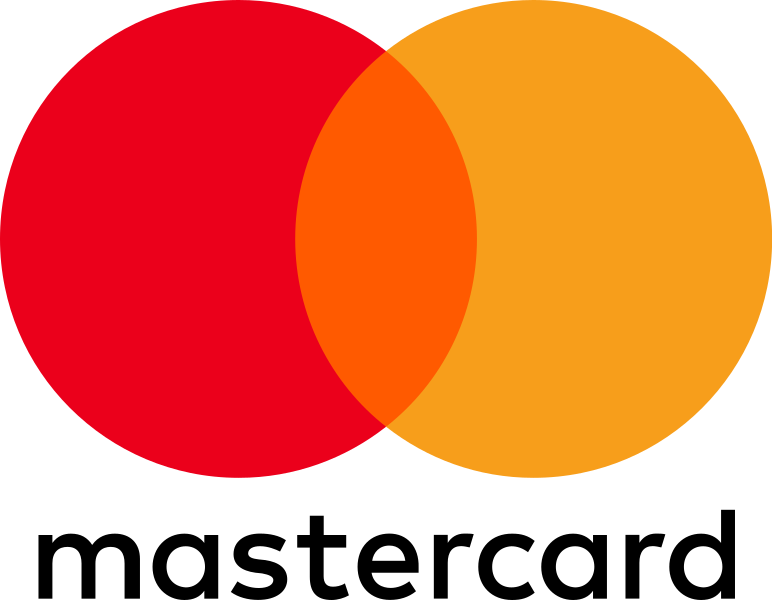

Bestell-Informationen
Service / Kontakt
Kontakt



