PTT - Persönlichkeitsstörungen: Theorie und Therapie, 2024, Jg. 28, Ausgabe 2
Setting
Print-Ausgabe
eJournal
Bibliographische Angaben
Details
Der Artikel diskutiert das Konzept der »Ambulantisierung« im Kontext der Gesundheitsreformen in Deutschland mit besonderem Fokus auf die psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung. Er untersucht die Herausforderungen und Chancen, die der Übergang von der stationären zur ambulanten Versorgung mit sich bringt und betont die Notwendigkeit eines ausgewogenen Ansatzes zur Aufrechterhaltung der Qualität bei gleichzeitiger Bewältigung von Ressourcenengpässen. Zu den zentralen Themen gehören die politische Bedeutung der Ambulantisierung, ihre Auswirkungen auf Gesundheitsstrukturen und Erstattungsmodelle sowie die Bedeutung einer koordinierten, patientenzentrierten Versorgung in verschiedenen Gesundheitsbereichen. Darüber hinaus werden die Komplexitäten der psychiatrischen Versorgung untersucht, beispielsweise die Integration psychosomatischer und psychiatrischer Dienste und die Rolle multiprofessioneller Teams bei der Gewährleistung einer umfassenden Behandlung. Weiterhin werden die laufenden Bemühungen zur Verbesserung der ambulanten Versorgung durch Initiativen wie die KSVPsych-Richtlinie beleuchtet und gleichzeitig die Notwendigkeit weiterer Forschung und Innovation anerkannt, um die Bereitstellung psychischer Gesundheitsversorgung in der Zukunft zu optimieren.
The article discusses the concept of »outpatientization« (Ambulantisierung) in the context of healthcare reforms in Germany, particularly focusing on psychiatric and psychotherapeutic care. It examines the challenges and opportunities posed by transitioning from inpatient to outpatient care, emphasizing the need for a balanced approach to maintain quality while addressing resource constraints. Key themes include the political significance of outpatientization, its implications for healthcare structures and reimbursement models, and the importance of coordinated, patient-centred care across various healthcare settings. Additionally, it explores the complexities of psychiatric care delivery, such as the integration of psychosomatic and psychiatric services and the role of multi-professional teams in ensuring comprehensive treatment. The article highlights ongoing efforts to enhance outpatient care through initiatives like the KSVPsych-Guideline, while acknowledging the need for further research and innovation to optimize mental healthcare delivery in the future.
Individualisierte ambulante und im Fall von STÄB primär im häuslichen Umfeld stattfindende Therapieprogramme bieten einen effektiven Ansatz in der Behandlung von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen und in unserem Beispiel mit BPS. Sie können eine wertvolle Ergänzung darstellen, die es Patient*innen ermöglichen, sich in ihrem gewohnten Umfeld sich therapeutisch bei erhaltenem Autonomieerleben weiterzuentwickeln, und zudem Spielraum für ein flexibleres und an die individuellen Bedürfnisse der Patient*innen angepasstes Vorgehen bieten.
Individualized therapy programs that take place primarily in the home environment offer an effective approach in the treatment of people with severe mental illnesses and, in our example, with BPD. These can be a valuable addition that enable patients to develop themselves therapeutically in their familiar environment while maintaining an experience of autonomy and also enable a more flexible approach adapted to the individual needs of the patient.
Persönlichkeitsstörungen stellen den ambulanten Rahmen der Sozialpsychiatrie vor besondere Herausforderungen. Gleichzeitig bietet das Setting viele Möglichkeiten, effektiv auf die nach psychotherapeutischer Behandlung häufig anhaltenden psychosozialen Folgen von Betroffenen einzuwirken. Nicht zuletzt im Rahmen der Ambulantisierung ist zu erwarten, dass ihr Anteil in diesem Bereich psychiatrischer Versorgung weiter zunimmt. Die typischen Probleme und spezifischen Einflussfaktoren der ambulanten Sozialpsychiatrie bei Persönlichkeitsstörungen werden herausgearbeitet und insbesondere vor dem Hintergrund der Effektivität diskutiert. Ausgehend davon wird praxisgeleitet ein störungsspezifischer Ansatz entworfen, in seinen Prinzipien sowie der möglichen Umsetzung beschrieben und die Übertragungsfokussierte Psychotherapie als methodischer Bezugsrahmen vorgeschlagen.
Personality disorders confront the outpatient setting of social psychiatry with particular challenges. Yet this setting also offers great opportunities to effectively intervene in the psychosocial consequences of those affected, which often persist after psychotherapy. Not least in the context of ambulantization, it is to be expected that their proportion in this area of psychiatric care will continue to increase. The typical problems and specific factors influencing outpatient social psychiatry for personality disorders are analyzed and discussed against the background of effectiveness. Based on this, a disorder-specific approach is developed from a practice-oriented perspective, its principles and possible implementation are described, and transference-focused psychotherapy proposed as a methodological framework.
Neben der bereits manualisierten und evidenzbasierten Übertragungsfokussierten Psychotherapie (TFP) im Einzelsetting bewährt sich klinisch eine TFP-orientierte psychodynamische Gruppentherapie zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen. Letztere fokussiert insbesondere die Bearbeitung aktivierter und agierter destruktiver Beziehungsmuster und negativer Affekte. Im Text werden die TFP-Einzeltherapie und die TFP-Gruppentherapie gegenübergestellt, Möglichkeiten und Grenzen der Verfahren diskutiert und Überlegungen zu Kombinationsbehandlungen angestellt.
In addition to the already manualized and evidence-based transference-focused psychotherapy (TFP) in the individual setting, a TFP-oriented psychodynamic group therapy for the treatment of personality disorders has proven itself clinically. The latter focuses in particular on processing activated and acted-out destructive relationship patterns and negative affects. The text compares TFP individual therapy and TFP group therapy, discusses the possibilities and limitations of the methods and provides considerations for combined treatments.
Die limitierte nonverbale Kommunikation ist einer der meistgenannten Nachteile der Psychotherapie per Videokonferenz (VP). Es wurden die Antworten von 284 Psychotherapeut:innen in einer Umfrage zum Thema »Online-Psychotherapie« einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Die Ergebnisse gliederten sich in die drei Hauptkategorien »Verlust der nonverbalen Kommunikation«, »Verlust der Leiblichkeit« und »Verlust der Atmosphäre«. Es wurde gezeigt, dass die nonverbale Kommunikation im Online-Setting auf vielfältige Weise verloren geht und sich dies insbesondere auf die Gegenübertragungsgefühle in der Arbeit mit Patient:innen mit schweren Persönlichkeitsstörungen limitierend auswirkt.
Limited nonverbal communication is one of the most frequently cited disadvantages of psychotherapy via videoconferencing (VP). Responses from 284 psychotherapists in an survey on »online psychotherapy« were subjected to qualitative content analysis. Results were organized into three main categories, »loss of nonverbal communication,« »loss of physicality,« and »loss of atmosphere«. The results show that nonverbal communication is lost in many ways in VP, which has a particularly limiting effect on countertransference feelings when working with patients with severe PD.
Die Familien von Patient:innen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sind in vielfältiger Weise von der Störung mitbetroffen. Ihr Verhalten ist manchmal Auslöser von dysfunktionalem Verhalten der Betroffenen, manchmal wird dieses auch verstärkt. Und Familienangehörige leiden unter einer erhöhten Belastung. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, Angehörige in die Therapie miteinzubeziehen. Da in Zeiten von Covid-19 die Durchführung von Live-Gruppen nicht möglich war, untersuchten wir, ob Online-Gruppen von betroffenen Familien akzeptiert werden und ob es möglich ist, in diesen Gruppen eine vertrauensvolle Beziehung herzustellen. Dazu rekrutierten wir insgesamt 8 Patient:innen und 20 Angehörige. Die randomisierte Zuordnung zu Interventions- und Kontrollgruppen war aufgrund der geringen Teilnehmerzahl allerdings nicht möglich. Die Teilnehmer:innen wurden gebeten, nach jeder von acht Sitzungen ein Feedback abzugeben. Die Ergebnisse dieser Pilotstudie legen nahe, dass Familieninterventionen, die synchron online über Videokommunikationsdienste durchgeführt werden, gut angenommen und akzeptiert werden. Außerdem bieten sie eine gute Möglichkeit gerade für Teilnehmer:innen, deren Wohnorte verstreut liegen.
The families of patients with borderline personality disorder are affected by the disorder in many ways. Their behavior sometimes triggers dysfunctional behavior in those affected, and sometimes this is also reinforced. And family members suffer from an increased burden. For this reason, it seems sensible to include family members in the therapy. Since it was not possible to conduct live groups in times of Covid 19, we investigated whether online groups are accepted by affected families and whether it is possible to establish a trusting relationship in these groups. To this end, we recruited a total of 8 patients and 20 relatives. The online group was conducted via the Zoom video conferencing service by two experienced psychotherapists. However, randomized assignment to the intervention and control group was not possible due to the small number of participants. The participants were asked to provide feedback after each of the 8 sessions. The results of this pilot study suggest that family interventions conducted synchronously online via video communication services are feasible and acceptable. They also offer a good opportunity, especially for participants whose homes are scattered.
Wie in den meisten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gibt es auch in der Psychotherapie eine Trennung zwischen »normal« und »anders«. Ein:e Patient:in, der:die blind ist, wird zur letztgenannten Kategorie gezählt und kann in sehenden behandelnden Personen Stereotypen, Unsicherheiten und Ängste aktivieren, die wiederum eine schädigende Wirkung auf die Behandlung dieser Patient:innen haben können, wenn sie nicht ausreichend reflektiert werden – insbesondere dann, wenn es sich um eine Borderline-Persönlichkeitsstörung handelt. Inwiefern dies auch in einer Behandlung mittels der Übertragungsfokussierten Therapie (TFP) wesentlich ist, soll – mit einem Fallbeispiel illustriert – im folgenden Beitrag dargestellt werden.
In most areas of social life, there is a distinction between »normal« and »abnormal,« and this division also exists in psychotherapy. A patient who is blind falls into the latter category, triggering stereotypes, uncertainties, and fears in sighted treating individuals. These reactions can have a detrimental effect on the treatment of these patients if they are not sufficiently reflected upon – especially when dealing with borderline personality disorder. The extent to which this is essential in the context of treatment using Transference-Focused Psychotherapy (TFP) will be discussed in the following article and illustrated by a case example.
Es scheint, als würde die sogenannte tiergestützte Psychotherapie gerade modern. Allenthalben kann man an Fortbildungen teilnehmen und beispielsweise lernen, wie man den Hund oder das Pferd in die Psychotherapie mit einbeziehen kann. Dabei gewinnt man den Eindruck, als basiere der Großteil der Fortbildungen auf der Verhaltenstherapie. Das mag eher nicht überraschen, hat doch die Verhaltenstherapie prinzipiell weniger Schwierigkeiten damit, die Therapie auch außerhalb des Therapiezimmers durchzuführen, was für psychodynamisch arbeitende Therapeut*innen eher ungewöhnlich anmutet. Die Autorin arbeitet seit einigen Jahren psychotherapeutisch mit einer (relativ kleinen) Stute, einem Island-Pony. Im Beitrag werden einige psychodynamische Überlegungen zum Einsatz eines Pferdes in der Psychotherapie beschrieben, insbesondere hinsichtlich der Dimensionen Kontaktaufnahme sowie Raumeinnehmen und -schaffen.
It appears that so-called animal-assisted psychotherapy is becoming modern. Training sessions are offered at many places and learn, for example, how a dog or a horse can be included in psychotherapy. The impression one gains is that most of such sessions are based on behavioral therapy. That may not be surprising as behavioral therapy essentially has less difficulties offering treatment outside the therapy room something that may seem more unusual for therapists with a psychodynamic approach. The author has worked for some years in psychotherapy with a (relatively small) mare, an Iceland pony. Here, she offers some psychodynamic ideas on the use of a horse in psychotherapy, in particular in the areas of creating contact, asserting one’s space, and creating space.
Autor:innen
Otto F. Kernberg(Hrsg.)
Otto F. Kernberg, 1928 in Wien geboren, ist Professor Emeritus für Psychiatrie an der Cornell University und Direktor des Personality Disorders Ins...
Otto F. Kernberg, 1928 in Wien geboren, ist Professor Emeritus für Psychiatrie an der Cornell University und Direktor des Personality Disorders Institute am New York-Presbyterian Hospital. Er war lange Vorsitzender der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung. Kernberg ist einer der führenden Denker in der Psychoanalyse und gilt als »kompetentester Spezialist für schwere Persönlichkeitsstörungen« (Eva Jaeggi in Psychologie heute).
2012 erschien der Film »Einführung in die...
Götz Berberich(Hrsg.)
Götz Berberich, Dr. med., Chefarzt der Psychosomatischen Klinik Windach, Lehrkrankenhaus der LMU München, Leiter der Privatambulanz. Lehrauftrag an...
Götz Berberich, Dr. med., Chefarzt der Psychosomatischen Klinik Windach, Lehrkrankenhaus der LMU München, Leiter der Privatambulanz. Lehrauftrag an der LMU, Verhaltenstherapeut und Psychoanalytiker.
Peer Briken(Hrsg.)
Prof. Dr. med. Peer Briken, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Forensische Psychiatrie, Sexualmedizin (DGfS, FECSM); Professor für Sexual...
Prof. Dr. med. Peer Briken, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Forensische Psychiatrie, Sexualmedizin (DGfS, FECSM); Professor für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie uns Direktor des gleichnamigen Instituts am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. 1. Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung und Vicepresident der International Association for the Treatment of Sexual Offenders.
Anna Buchheim(Hrsg.)
Anna Buchheim, Prof. Dipl.-Psych. Dr. biol. hum., Psychoanalytikerin, Professorin für Klinische Psychologie/Klinische Emotionsforschung an der Univ...
Anna Buchheim, Prof. Dipl.-Psych. Dr. biol. hum., Psychoanalytikerin, Professorin für Klinische Psychologie/Klinische Emotionsforschung an der Universität Innsbruck
Stephan Doering(Hrsg.)
Stephan Doering, Univ.-Prof. Dr. med., Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Psych...
Stephan Doering, Univ.-Prof. Dr. med., Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychoanalytiker (Wiener Psychoanalytische Vereinigung, Internationale Psychoanalytische Vereinigung). Lehrtherapeut für Übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP). Leiter der Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien, dort Lehrstuhl für Psychoanalyse und Psychotherapie. Past President der European Society for the Stud...
Birger Dulz(Hrsg.)
Birger Dulz, Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie; Chefarzt der II. Fach...
Birger Dulz, Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie; Chefarzt der II. Fachabteilung (Persönlichkeitsstörungen/Trauma) der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Asklepios Klinik Nord/Ochsenzoll, Hamburg; Arbeits- und Forschungsschwerpunkt: stationäre Psychotherapie von Borderline-Störungen 2009 Preis der Dr. Margrit Egnér-Stiftung
Susanne Hörz-Sagstetter(Hrsg.)
Susanne Hörz, Dr. phil. Dipl-Psych., wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Klinische Psychologie im Department Psychologie, Fakultät für...
Susanne Hörz, Dr. phil. Dipl-Psych., wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Klinische Psychologie im Department Psychologie, Fakultät für Psychologie und Pädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München, Projektmitarbeiterin in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der TU München, Vorstandsmitglied im TFP-Institut München e. V.
Maya Krischer(Hrsg.)
Martin Sack(Hrsg.)
Prof. Dr. med. Martin Sack ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und stellv. Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapi...
Prof. Dr. med. Martin Sack ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und stellv. Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Klinikums rechts der Isar der TU München. Er ist seit vielen Jahren auf die Behandlung von PatientInnen mit Traumafolgestörungen spezialisiert und als Supervisor und Ausbilder tätig.
Hefte der gleichen Zeitschrift
Alle Hefte der Zeitschrift
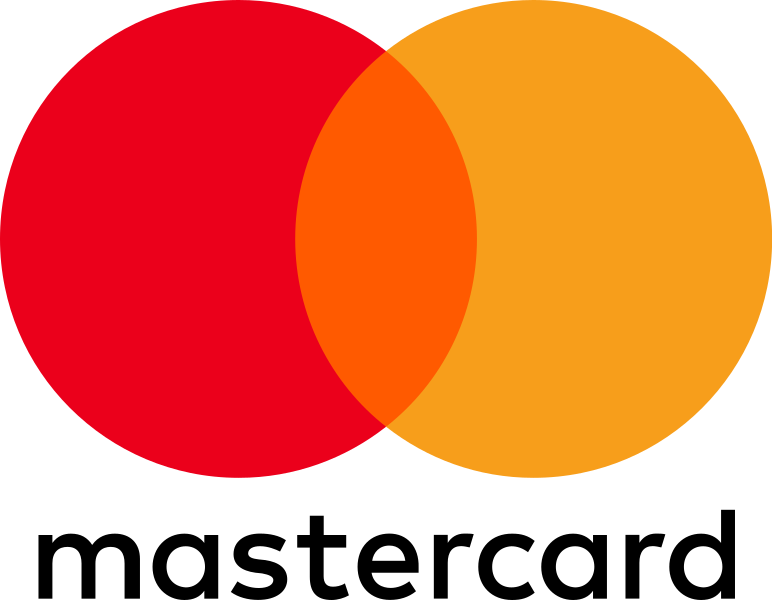

Bestell-Informationen
Service / Kontakt
Kontakt



